 Hans
Graf Gartenbau CH-3065
Bolligen hansgraf@bluewin.ch
Hans
Graf Gartenbau CH-3065
Bolligen hansgraf@bluewin.ch
Die Gärten in Deutschland
/ Teil 3
Lütetsburg
Der
Name Lütetsburg geht auf den Häuptling Lütet Manninga zurück. Seit dem 16.
Jh. befindet sich der Besitz in der Familie zu Inn und Knyphausen. Der Renaissancegarten
lag auf der Westseite des Wasserschlosses, der Barockgarten vor der Südfront.
1790 begann Graf Edzard Mauritz zu Inn und Knyphausen (17481824) mit der Anlage
des Landschaftsgartens im frühromantischen Stil. Der Garten zählt zu den wenigen
auf dem Kontinent erhaltenen Beispielen dieses Typus. J. Bosse war hier von
181214 tätig und zeichnete den bedeutsamen Gartenplan. Der Park, für den Wörlitz
konzeptionell ein Vorbild bot, zeigt starke chinesische Einflüsse, die in
den geschlängelten Wasserläufen, Inseln, Brücken und reithgedeckten Gartengebäuden
zum Ausdruck kommen. 1793 starb die Ehefrau des Gartenschöpfers, gemäß seinem
Wunsch wurde sie nicht in der Gruft der Patronatskirche, sondern auf der „Insel
der Seligen" im Tempel der Natur beigesetzt. 1797 entstand das Teehaus,
der „Tempel der Freundschaft", es ist einem Gartenfreund in Berlin gewidmet.
1802 erfolgte der Bau der Norwegischen Kapelle. Die Inschrift in der Kuppel
„Natur und Tugend führen zu Gott" stellt den Glaubenssatz der deutschen
Aufklärung dar: sich durch das Geistig-Schöne
hier die von Menschenhand geschaffene idealisierte Natur
zu Gott führen zu lassen. Dieses Wort veranschaulicht den Bedeutungszusammenhang
zwischen der damaligen Auffassung von Natur, Ästhetik und Tugend.
Der
Garten sollte als Gleichnis des menschlichen Daseins betrachtet werden, ein
Spaziergang als ein Fortschreiten durch die Bezirke geistiger Entwicklung,
dargestellt durch Pflanzen, Monumente und Inschriften. Es wird deutlich, daß
der tiefste Bezug des Grafen zu seinem Land ein
im Sinne des Gartenphilosophen Hirschfeld ästhetisch-moralischer gewesen ist. Er war überzeugt,
mit seiner Parkanlage auch für seine Nachkommen einen bleibenden Wert geschaffen
zu haben. Das ersehnte Ziel war: hier geboren werden, hier leben, sterben
und begraben sein. Fürst Wilhelm Edzard zu Inn und Knyphausen (19081978) betrachtete
die alte Gartenanlage entgegen der
damaligen Auffassung anderer Besitzer historischer Gärten
als ein Gartendenkmal und ließ ab 1932 umfangreiche Restaurierungsarbeiten
durchführen. Nach 1945 galt sein Engagement der Beseitigung der Kriegsschäden
und dem Wiederaufbau des 1956 durch
Brand zerstörten Schlosses. Bis zu
seinem Tod schuf Fürst Knyphausen an der Südflanke großzügige Ausgestaltungen
und Erweiterungen. Der Park besitzt
einen herrlichen Altbaumbestand, eine
Fülle von seltenen Gehölzen und zahl reiche Rhododendron und Azaleensorten.
Mit dem Passieren der Großen Pforte verläßt der Besucher
vielleicht zunächst noch unbewußt
die Alltagswelt und betritt ein irdisches Arkadien, ganz im Sinne
des Gartenschöpfers, wie es heute kaum
mehr Gärten zu vermitteln vermögen. Mit
diesem Park ist ein solcher Traum Wirklichkeit geworden.
Text:
Eberhard Pühl; in: Parks und Gärten - zwischen Weser und Ems
Schlosspark Jever
Der
Schloßgarten in Jever 1828 erfolgte unter Herzog Peter Friedrich Ludwig die
Anlage des Schloßgartens, zugleich der Bau der beiden Torhäuser am Eingang
des Schloßhofes, wie der der beiden Gartenpforten. Der Oldenburger Hofgärtner
Julius Bosse lieferte den Entwurfsplan. Dank seinem Können gelang es, auf
einem nur drei Hektar umfassenden Gelande diesen einzigartig reizvollen Landschaftsgarten
zu entwickeln. Im Wechselspiel mit der rahmenden Graft, einer feinen Geländemodellierung
und einer geschickt konzipierten Wegeführung, die weite Durchsichten ermöglicht, ist die Illusion
eines wesentlich größer erscheinenden Parks entstanden. Alte Baumriesen, darunter
mächtige Rot und Blutbuchen, Eschen und Linden, bilden faszinierende Blickpunkte.
Seltene Gehölze wecken die Aufmerksamkeit des Pflanzenliebhabers, darunter
der Kadsurabaum (Cercidiphyllum japonicum) und der Ginkgo (G. biloba), dem
Goethe ein Gedicht gewidmet hat, der Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera)
und Amberbaum (Liquidambar styraciflua). An der Südwestecke ist die frühere
Bastion als Hügel erhalten geblieben, von hier reicht noch heute der Blick
bis zum blauschimmernden Upjeverschen Wald, wo einst die großherzoglichen
Jagden stattfanden. Zauberhaft ist es, im Frühsommer oder auch an einem nebligen
Herbsttag einen Rundgang von Gartenpforte zu Gartenpforte zu unternehmen.
Zur einen Seite das geschichtsreiche Gemäuer, zur anderen Seite die rahmende
Graft und altehrwürdige Bäume.
Haucke’s
 |
 |
Was soll man denn
dazu sagen. Nein, es ist nicht die Perfektion in Reinkultur. Aber es ist die
Liebe zum Garten gepaart mit überragenden Kenntnissen und feinem Gespür für
die Kunst, welche diesen Garten auszeichnen. Wolgang Haucke, von Beruf Goldschmied,
betätigt sich in seiner Freizeit als begnadeter Bildhauer. Es entzieht sich
meiner Kenntnis, ob er ausserhalb der im Garten aufgestellten noch andere
Objekte entworfen hat. Zu wünschen wäre es. Diese hingegen stehen vor einer
sumpfigen Mulde inmitten einer Wiese in einiger Distanz zum Haus. Man fühlt
sich von ihnen förmlich angezogen, umkreist sie in erfurchtsvoller Distanz,
lässt ihre Ausstrahlung auf einen wirken. Man versucht sie zu durchdringen,
was kläglich misslingt. Die Gestalt hält jedem analytischen Ansturm stand.
Dann wird man verführt, den Garten zu erkunden.
Ein Rundweg führt einen zunächst in dunklere, bewaldete Regionen, wo einem
die Hexen und Kobolde nur so entgegenfliegen.
Und dann die Hostas. Über 250 Arten soll Hille Haucke hier pflegen.
Sie gilt als die grosse Pflanzenkennerin im Team. Die hellen und weissgeränderten
erhellen gleichsam den Weg, den man entlangschlendert. Immer wieder sind es
Nischen und verborgene Ecken und Winkel, die einen beinahe erschrecken. Selbstverständlich
blühen im Frühjahr unter den Birken zahllose Osterglocken und noch früher
ist dies der Ort, wo die Christrosen gedeihen.
die einen beinahe erschrecken. Selbstverständlich
blühen im Frühjahr unter den Birken zahllose Osterglocken und noch früher
ist dies der Ort, wo die Christrosen gedeihen.
Endlich gelangt
man wieder in die Nähe des Hauses,
wo man zunächst von in Eibe geschnittenen grossen Äpfeln und Birnen bewirtet
wird. Auf dem Hofplatz akzentuiert ein schöner Katsurabaum den Mittelpunkt.
Die herzförmigen Blätter verströmen im Herbst einen wunderbaren Kuchenduft.
Aus der anderen Seite tummeln sich
die Hortensien und dahinter, im schönsten, sonnigsten Stück des Gartens, eröffnet
sich der prächtige Blumengarten. Natürlich haben
sie ein wenig geschummelt. Trotz sintflutartiger Niederschlägen, die vor wenigen
Tagen niedergegangen sind, empfängt einen ein Blütenmeer, hervorgezaubert
im Augenblick vor allem durch die Lavathera und die Malven. Dazwischen mischen
sich ganz kokett einzelne gelbe Inula. Alles hübsch eingefasst in Buchsborduren,
welche die nötige Ordnung bewerkstelligen. Dass die Flachländer immer ein
wenig Sehnsucht nach den Bergen haben manifestiert sich im kleinen Steingarten,
wo aus unzähligen Reisen Steine herangeschleppt und zu einem einheitlichen
Ganzen zusammenkomponiert wurden.
Man
möchte stundenlang verweilen, geniesst den Kaffee und die Gebäcke, die gereicht
werden, gerät ins Fachsimpeln und wundert sich nicht mehr, wenn in allen anderen
Gärten ehrfurchtsvoll von den Hauckes
gesprochen wird. Es wird noch einige Male regnen müssen, bis sie erreicht
sind. Übertreffen kann man sie nicht.
Stünkel
 |
 |
Ich
träume. Anders ist es nicht zu erklären, was man hier sieht. Zuerst ist Herr
Stünkel skeptisch, wie wir einfach so aufkreuzen, taut aber unvermittelt auf,
wie er hört, dass wir aus der Schweiz sind. Hat er doch selber etliche Jahre
als Gärtner und als Orthopäde in der Schweiz gearbeitet, bevor er sich dieses
Stück Land in Norddeutschland erobert hat. Stünkel
ist durch und durch Gärtner, weniger vielleicht Gestalter. Der Garten ist
zunächst ein Pachwork unterschiedlicher Ideen. Als Reminiszenz an die Schweiz
wurde gar ein Berg gestaltet in der Form eines sanften Hügels, auf dem ein
selbst gebautes kleines Gästehaus steht. In diesem, weniger intensiv durchgestalteten
Bereich dominieren die sanften Wellen und die Rhododendren. Wiesen ziehen
sich dahin, über den Berg führt ein geschwungener Weg, begleitet von einem
hainartigen Baumbestand. Ausgangspunkt des Weges ist eine senkrechte Mauer,
die sich direkt an das Wohnhaus anlehnt und
dort eine Art kühles Sommerzimmer bildet. Das besondere an der aus feinen
Natursteinen gemauerten Wand ist ihre Ausbildung als Wasservorhang. Durch
einen raffinierten Mechanismus fällt ein feiner Wasserfall darüber und versprüht
im Sommer  wohltuende Kühle. Zur Zeit ist der Hausherr
gerade an einem komplizierten Bodenbelag beschäftigt, mit welchem ein neuer
Sitzplatz ausgelegt werden soll.
wohltuende Kühle. Zur Zeit ist der Hausherr
gerade an einem komplizierten Bodenbelag beschäftigt, mit welchem ein neuer
Sitzplatz ausgelegt werden soll.
Aber
das ist nur die Rückseite des Gartens, das einfache, weitläufige.
Die
Konzentration findet im vorderen Bereich statt. Horst Stünkel ist der stilsichere
Gärtner mit dem Instinkt für das, was zusammen passt. Bei ihm steht nicht
der Gesamtentwurf im Vordergrund, sondern das Detail. Und trotzdem oder vielleicht
gerade deshalb passt alles wunderbar zusammen. Nirgends wird krampfhaft versucht,
etwas in einen vorgegebenen Rahmen einzupassen. Dieser wird einfach gesprengt,
wenn beispielsweise eine kleine Kapelle errichtet werden soll aus Bauteilen,
die man vor der Zerstörung gerettet hat. Und der Verlauf des Baches wird so
lange korrigiert, bis die Gefällsverhältnisse stimmen. Die Bepflanzung wird
so lange ergänzt, bis das Gesamtbild des kleinen Gevierts den Vorstellungen
entspricht. Unzählige liebevoll gepflegte Details findet man im Garten, und
doch verliert man sich nie. Die grossen Ausblicke und Sichtachsen sind gewahrt,
der Zusammenhalt immer da. Es ist ein kleines Wunder.
Klosterkielhof
 |
 |
Anfang der siebziger
Jahre erwarben der Landschaftsarchitekt Joachim Winkler und seine Familie
den zwischen Oldenburg und Hude gelegenen und aus dem Jahr 1815 stammenden
Bauernhof.
Außer einigen
Eichen, einer in der Nähe des Hauses stehenden Linde und an den Grundstücksgrenzen
wachsenden Wallhecken war kein weiterer Bewuchs vorhanden. Das Ehepaar Lisa
und Joachim Winkler legten nach und nach einen komplett neuen Garten an, der
den ländlichen Charme der inzwischen liebevoll restaurierten Hofanlage widerspiegelt.
Die Zufahrt zum Hof wurde durch eine Obstbaumallee geführt. Der Gartenbereich
von insgesamt 8000
m2 ist mit Buchenhecken umschlossen, die den Wind brechen helfen. Es entstanden
acht unterschiedliche Gartenräume, die alle eine intensive Staudenbepflanzung
in Kombination mit interessanten Gehölzen gemeinsam haben. Der Gartenbesucher
kann sich im hausnahen Buxusgarten von den Düften der Rosen und mancherlei
Kräutern verzaubern lassen. Dem farbenfrohen
Iriskabinett folgt ein durch Hecken umschlossenes Gartenzimmer, dem weißblühende
Pflanzen um einen alten Sandsteinbrunnen zugeordnet wurden. Im formalen, durch
Spalierobst begrenzten Gemüsegarten, sind die Rosen »Rambling Rector« und
»Raubritter« zur Blütezeit eine rosa-weiße Pracht. Hinter einem zum Verweilen
einladenden Gartenpavillon, schließt sich der 1800 m2 große Rhododendrongarten
an.Waldstauden, Farne und Gräser beleben auch nach der Rhododendronblüte das
Gesamtbild durch unterschiedliche Blattstrukturen und Farbenspiele. Wechselnde
Skulpturenausstellungen, Symposien, Konzerte und Vorträge werden jeweils in
den Sommermonaten angeboten.
Das war bislang
so. Winklers haben ihren Sitz verkauft und im Augenblick wird heftig daran
gebaut und renoviert. Der Garten ist
immer noch in Ordnung, soll zudem weiterhin instand gehalten und ab 2003 wieder
der Öffentlichkeit zugänglich sein.
Skulpturengarten Bertram
 |
 |
Der Garten des
Ehepaares Bertram liegt in der Nähe von Ganderkesee. Das Grundstück ist circa
2500 m2 groß und befindet sich am Rande eines Waldgebietes. Von dem Gartenarchitekten
Köhler wurde das Grundkonzept für die Gartenanlage entwickelt.
In dem eher sachlich
gestalteten Garten dominiert besonders ein etwa 15 m langes formal aufgemauertes
Wasserbecken. Parallel zum Wohnhaus erstreckt sich eine 25 m lange Trockenmauer
aus rötlichem Porphyr. In ihrem Bereich sind verschiedene Staudenarten gruppenweise
gepflanzt worden und über die Vegetationszeit als farbige Blütenfelder zu
bewundern. Von der großzügig gestalteten Terrasse erschließt
ein gepflasterter Weg den weiteren Gartenbereich und mündet in einem dekorativen
kleinpflaster-Rondell, dessen Mitte mit einer Skulptur (großer weiblicher
Torso von Gustav Seitz) besetzt ist. Neben dieser »weiblichen Schönheit« sind
noch weitere Skulpturen der klassischen Moderne im Hausgarten des Ehepaares
Bertram zu finden. Thema des Gartens ist es, eine Symbiose von Natur und Kunst
herzustellen. Der bewusst streng gehaltene Rahmen des Gartens unterstreicht
die einzelne Schönheit
der Skulptur und richtet die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sie. Andererseits
umspielen die Stauden, Kletterpflanzen und Gehölze auch die Kunstobjekte.
Es entwickelt sich ein wechselvolles Spiel in Hinblick auf Formen, Farben,
Licht und Schatten. Bedingt durch den Wechsel der Jahreszeiten erscheinen
die Skulpturen für den Betrachter ebenfalls in einem ständig variierenden
Bild.
Das Arboretum Ellerhoop-Thiensen
 |
 |
Was heute an Ellerhoop-Thiensen interessiert,
ist das Arboretum. Im Jahre 1956 wurde es von der Baumschule Timm & Co
aus Elmshorn angelegt.
Der damalige Inhaber ließ eine Fläche von 3,75 Hektar, die an den historischen
Münsterhof grenzt, mit vielen verschiedenen Gehölzen bepflanzen.
1980 stand das Gelände zum Verkauf und wurde vom Kreis Pinneberg mit Zuschüssen
des Förderfonds "Naherholung Hamburger Umland" erworben. Inzwischen
ist das Gelände auf ca. 17,3 Hektar angewachsen, und es gibt hier über 4000
verschiedene Baumarten und Pflanzensorten.
1988 wurde der Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Thiensen e.V. gegründet,
der inzwischen über 1400 Mitglieder verfügt und dessen Vorsitzender Professor
Dr. Hans-Dieter Warda Ist. Der Förderkreis hat am 1.1.1996 die Betriebsträgerschaft
für die Anlage übernommen. Jährlich besuchen 100.000 Gartenfreunde und auch
Erholungssuchende aus allen Teilen Europas das Arboretum, um sich fachlich
inspirieren zu lassen oder einfach die Schönheiten des Parkes zu genießen.
Das ist alles, was
einem von diesem wundervollen Park an Text zur Verfügung gestellt wird. Denn
man gerät wirklich ins Schwärmen, wenn man durch diese Gärten und an den Objekten vorbei wandert. 40
Punkte werden insgesamt aufgezählt und da sind die vielen Einzelbäume natürlich
nicht mitgezählt. Die Parkanlage wurde
vielleicht etwas altmodisch im englischen Stil angelegt. Aber diese ruhige,
sozusagen leere Form, die aber doch einen starken Rahmen bildet, eröffnet
die Möglichkeit, unzählige Einzelthemen hinein zu komponieren. Und dvon wird
in der Folge reichlich Gebrauch gemacht, ohne dass irgend einmal das Gefühl
von Überfülle aufkommt. Natürlich sind
es hauptsächlich die traditionellen Formen, die einem begegnen. Der Bauerngarten
fehlt ebenso wenig wie der Rosen- und der Heidegarten. Ganz neu wurde auch
ein kleiner chinesischer Garten angelegt mit einer sehr schönen Pfingstrosensammlung.
Verblüffend ist aber der Ausblick auf die Teichanlage über die Lotosblüten
hinweg zu den Supfzypressen. Dahinter verbirgt sich gar noch ein Dinosaurier,
der im geologischen Lehrpfad zusammen mit den Urweltpflanzen natürlich dazu
gehört. Ein gemächliches Wandern ist angesagt, bei dem man immer wieder stehen
bleibt, gefangen genommen von einem hübschen Ausblick oder einem besonderen
Objekt.
Park der Sinne,
Hannover/ Laatzen
 |
 |
Beginnen Sie
am Südtor, so gelangen Sie unmittelbar zum Treffpunkt am Wasser, einem Ort,
der zum Verweilen einlädt: Lassen Sie Ihren Blick über die Mauer des Rondells
schweifen oder versuchen Sie, von der Brücke aus, die Tiefe des Teiches zu
ergründen. Da ist das Leben im und am Wasser zu beobachten oder die Schönheit
der naturnah gestalteten Uferzone zu bewundern. Der Weg über die Trittsteine
fordert Sie zum Gang über das Wasser auf. Der Weg führt an dem naturnah üppig
bewachsenen Nordufer entlang zum Garten der Düfte.
In einem Halbrund liegt der
Garten der Düfte am warmen, sonnigen Südwesthang des Aussichtshügels. In den
mit Trockenmauern gefassten Beeten verströmen die vielfältigsten Stauden und
Zwerggehölze ihre würzigen, süßen oder fruchtigen Düfte. Viele dieser Pflanzen
wurden und werden noch heute als Heilpflanzen genutzt. Riechen, fühlen, schmecken
und sehen Sie!
In einer steinigen
Mulde, die sich nach Westen hin öffnet und nach Nordosten hin durch steile
Felsblöcke abgeschirmt wird, speichert sich die Sonnenenergie. Als Wärme wird
sie von den Steinen wieder abgegeben. Grell reflektieren die hellen Kalksteinblöcke
das Sonnenlicht. An heißen Sommertagen flimmert und flirrt die Luft: Energie
wird sichtbar.
Wandern Spaziergänger in Richtung
Ort der Idylle, so kommen sie am Echo-Hof vorbei. In diesem Teil des Parks
können Sie Steine zum Singen bringen, dabei die unterschiedlichsten Klangkombinationen
erzeugen, Melodien spielen und einzelnen Tönen nachlauschen. Zwei gegenüberstehende
Parabolschalen ermöglichen es, sich über weite Distanz hinweg Botschaften
zuzuflüstern.
Der
Ort der Idylle ist ein ruhiger, warmer, rund um ein Wasserbecken angelegter
Ort. Umrahmt von einer Natursteinmauer und von einer berankten Pergola überdacht,
lädt er zum Verweilen und Entspannen ein. Das leise Plätschern des Wassers
sowie die Farben und Gerüche üppiger Staudenbeete schaffen ein wohliges Gefühl.
Auf
diesem Weg wird das Gehen mit oder ohne Schuhe zum Erlebnis. Grobe Kiesel,
gebrochene Sandsteinplatten, Pflastersteine, Holzbohlen und -pflaster, Klinker
und andere Materialien hochkant oder flach gestellt, bieten dem Gehenden mit
oder ohne Schuhe neue Körpererfahrungen. Am Zielpunkt lockt ein schon von
weitem sichtbarer Summstein mit ungeahnten Hörerfahrungen. Über den Steinigen
Weg, der als Erfahrungspfad des Gehens konzipiert ist, werden die Schritte
zum Ort der Begegnung gelenkt.
Der
Steinige Weg führt über eine Bodenerhebung, die den Ort der Begegnung umschließt.
Am höchsten Punkt steht ein Summstein aus porösem Basalt, der den Spaziergänger
animiert, seinen Kopf in die Höhlung zu stecken und die Verstärkung seines
leisen Brummen und Summen nicht nur akustisch, sondern auch physisch zu erfahren.
 Von diesem Punkt aus blickt der Spaziergänger
in den Ort der Begegnung hinab, einem kleinen Amphitheater mit breiten grasbewachsenen
Steinstufen, die etwa 250 bis 300 Besuchern während der Aufführungen als Sitz-
oder Stehplätze dienen können. Durch seine unmittelbare Nähe zum Nordeingang
ist der Ort der Begegnung ein hervorragender Treffpunkt zum Plaudern, Klönen.
Von diesem Punkt aus blickt der Spaziergänger
in den Ort der Begegnung hinab, einem kleinen Amphitheater mit breiten grasbewachsenen
Steinstufen, die etwa 250 bis 300 Besuchern während der Aufführungen als Sitz-
oder Stehplätze dienen können. Durch seine unmittelbare Nähe zum Nordeingang
ist der Ort der Begegnung ein hervorragender Treffpunkt zum Plaudern, Klönen.
Vorbei
an Wasserspielen führt der Weg am Bach entlang durch die Schlucht. Die Felswände
aus gelbem Sandstein ragen steil vor dem Spaziergänger auf. Kühle, feuchte
Atmosphäre umfängt ihn, sobald er die Schlucht betritt. Schatten breitet sich
aus. Farne, Gräser, Geißbart, Fingerhut aber auch Efeu haben sich in den Wänden
festgesetzt. Neben dem schmalen Pfad verläuft das Bachbett.
Am
Ende der Schlucht tritt der Spaziergänger in einen hellen und lichten Landschaftsraum
hinaus. In der Ferne sieht er das Trockental und den Garten der Düfte.
Nahe
dem Treffpunkt am Wasser zeigt das Spiel der Farben - ein mit weißen, gelben,
roten, blauen und violetten Tönen komponiertes Blütenmeer - die ganze Farbpalette
der Pflanzenwelt. Am Ende der geschwungenen Beete setzt jeweils ein farbiger
Stein den Schlussakzent.
Etwa
in der Mitte des Farbenspiels zweigt ein schmaler Seitenweg den Bach querend
zum Garten der Düfte hinab. Hinter dem steinernen Steg fächert sich der Bachlauf
auf, bevor er in den Teich mündet.
Zwischen
dem Garten der Düfte und dem Trockental steht eine Skulptur aus Sandstein.
Je nach Art des Lichtes, wurde die Oberfläche so unterschiedlich bearbeitet,
dass gleißendes Licht von ihr absorbiert und nicht reflektiert wird. Es wurde
ganz besonders die europäische Kultur aufgenommen. So verbindet der Sabbat-Tisch
die jüdische Tradition mit dem Ritual des christlichen Abendmahls.
Die von Hardy Girod geschaffene Skulptur
(gespaltener Stein) verkörpert das älteste Werkzeug der Welt, den Keil. Mit
Hilfe von Kraft und Energie ist der Keil in der Lage selbst härteste Werkstoffe
zu spalten. Bei der Skulptur wird dieser Spaltungsprozess durch eine Metallklammer
gestoppt. Das leuchtende Rot des Keiles und das tiefe Blau der Klammer unterstreichen
dabei die entstandene Spaltung und lassen sie in Verbindung mit dem natürlichen
oker, beige und rötlich gemaserten Sandstein bewußt im Raum wirken.
Herrenhausen
 Die eigentliche Entfaltung der feudalen Gartenkunst des Barock
begann in Deutschland, bedingt durch die Folgen des Dreißigjährigen Kriegs,
erst um 1680.
Die eigentliche Entfaltung der feudalen Gartenkunst des Barock
begann in Deutschland, bedingt durch die Folgen des Dreißigjährigen Kriegs,
erst um 1680.
Entsprechend der damaligen territorialen Zersplitterung
des Reiches spielten dabei unterschiedliche politische oder dynastische Beziehungen
der Fürstenhäuser, aber auch persönliche Vorlieben einzelner Herrscher eine
erhebliche Rolle traten infolgedessen
individuelle oder regionale Besonderheiten insgesamt deutlicher zutage als
in anderen Ländern. So verband sich der nun allenthalben zunehmende Einfluß
der französischen Gartenkunst im Süden häufiger mit fortdauernden Impulsen
italienischer Provenienz, im Norden mit solchen aus den Niederlanden. Zuweilen
und das gilt auch für den Großen Garten zu Herrenhausen bei Hannover wechselte in den verschiedenen Ausbauphasen
einer Anlage mit dem Bauherrn auch die Ausrichtung der künstlerischen Orientierung.
Als der kunstverständige
Herzog Johann Friedrich zu Braunschweig und Lüneburg 1665, unmittelbar nach
Übernahme der Regierung, beschloß, den damals noch weit vor den Toren Hannovers
gelegenen Wirtschaftshof seines Vaters in eine Sommerresidenz zu verwandeln,
haben ihn ohne Zweifel auch Erinnerungen an die Villen der venetianischen
Terraferma, die er bei seinen Italienreisen besucht hatte, beflügelt.
Auf einem um 1666 entstandenen Lageplan sind
die Umrisse der ersten, noch recht bescheidenen Anlage markiert. Neben dem
»Fürstlichen Lusthaus: Herrenhausen genannt« (dessen Seitenflügel von vornherein
einen zum Garten geöffneten Hof flankierten), lag damals ein Baumgarten. Das
etwa quadratische Areal des eigentlichen »Lustgartens« war durch einen auf
das Zentrum des Corps de logis gerichteten Mittelweg geteilt und durch zwei
Fischbecken begrenzt. Südlich von ihnen, also außerhalb der Gartengrenze,
führte eine Allee die Linie der Mittelachse bis zum Ufer des Leineflusses
weiter.
In einer zweiten, um 1673 einsetzenden Bauphase
wurden Schloß und Garten unter der Leitung des aus Venedig stammenden Hofarchitekten
Hieronymo Sartorio und des französischen, damals in Celle tätigen Gärtners
Henri Perronet erweitert. Von wem die dazu vorgelegten Gartenentwürfe stammen
und welcher von ihnen realisiert wurde, ist nicht bekannt. Nachgewiesen ist
lediglich, daß das Parterre, welches
seither die Fläche des ersten Lustgartens einnahm, neu geordnet und reicher
geschmückt wurde. Außerdem erhielt es eine rahmende Zone aus regelmäßigen
Obstpflanzungen und Bosketts. Zwei
besonders bedeutende und typische Elemente dieser Phase, die
»Haute Cascade« und die Grotte, existieren noch heute.
Ihre endgültige, für die Blütezeit der höfischen Kultur des Absolutismus
in Deutschland exemplarische Gestalt und Ausstattung erhielt die Sommerresidenz der Welfen
bezeichnenderweise erst nach 1680 durch
den Herzog und (seit 1692) Kurfürsten
Ernst August (Regierungszeit 16791698)
und seine Gemahlin Sophie.
Sie vor allem bemühte sich um die Verbesserung
und Vergrößerung der Anlage, von der sie noch 1713 schrieb: »Le jardin
de Hermhausen, qui es ma vie«. Daß sie dabei nicht nur
wie damals üblich Anregungen
in der französischen Gartenkunst suchte, sondern ebenso bei den Gärten der
Oranier, war naheliegend, denn sie
unterhielt zeitlebens enge Beziehungen zu den Niederlanden, wo sie 1630 (als Tochter des dort seit 1619 in der
Verbannung lebenden Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz) geboren
wurde und ihre Jugend verlebt hatte. Wahrscheinlich beabsichtigte Sophie von vornherein
die Vergrößerung des Herrenhäuser Gartens und ließ nicht zuletzt deshalb schon
1682 den begabten Gärtner Martin Charbonnier
aus Osnabrück (wo er seit 1677 für sie tätig gewesen war) nach Hannover kommen.
In den ersten eineinhalb Jahrzehnten ihres Wirkens gewissermaßen der dritten Ausbauphase in Herrenhausen
wurde aber zunächst einmal die überkommene Anlage komplettiert, so
durch die Aufstellung zusätzlicher Skulpturen oder durch
die Einrichtung des alsbald berühmten
Gartentheaters (16891693).Auch bemühte man sich immer wieder
freilich mit geringem Erfolg um
die Verbesserung der Wasserspiele.
Da das Schloß den wachsenden gesellschaftlichen Ansprüchen nicht mehr genügte,
wurde von 1694 bis 1700 neben ihm das
so genannte »Galeriegebäude« errichtet,
ein von Wohnpavillons flankierter Festsaal, der bis zum Bau der »Neuen
Orangerie« (17201723) zugleich als Winterquartier für die Kübelgewächse diente.
1695 hatte Martin Charbonnier noch einmal die
Oranier-Residenzen in Holland besucht. Ein Jahr danach begann unter seiner
Leitung die vierte und letzte Ausbauphase in Herrenhausen, die zu Beginn des
18. Jahrhunderts mit der Vollendung des »Großen Gartens« ihren Abschluß fand.
Nun wurde dem vorhandenen, orthogonal gegliederten
Areal (mit seinen neu gestalteten Parterres und Heckenbosketts) der annähernd
gleich große, aber gänzlich anders gestaltete und genutzte »Nouveau Jardin«
angefügt. Diese beiden, jeweils annähernd quadratischen Teile bilden seither
ein etwa 50 ha großes Rechteck, das von einem breiten, am Ende der Zentralachse
(die sich hier zu einem ovalen Platz weitet) apsidenförmig ausgebuchteten
Graben (der sogenannten »Graft«) und von rahmenden Alleezügen eingefaßt ist.
Zwei 1708 nach Entwürfen von Louis Remy de la Fosse errichtete Rundpavillons
markieren seine südlichen Eckpunkte.
Als die Kurfürstin Sophie am 8. Juni 1714 in ihrem geliebten Garten starb, dürfte
er so ausgesehen haben, wie ihn die meisten Pläne und Ansichten des frühen
18. Jahrhunderts zeigen. Man erkennt auf
ihnen die dreiflügelige Schloßanlage mit
dem nördlich vorgelagerten »Cour d'honneur« Halbrund und den seitlich der Galerieflügel gelegenen Kompartimenten:
im Westen hinter der »Haute Cascade« den
»Jardin prive« der Kurfürstin und im Osten hinter und neben der Grotte einen
»Jardin a melons et fruits«. Noch weiter
westlich liegt das Galeriegebäude mit
dem Orangeriegarten, dem sich nach Süden, in axialer Ausrichtung, das Gartentheater
anschließt. Weitere Heckenbosketts
mit Salons und Cabinets, zwei Quinconces
und vier aus den ehemaligen Fischteichen
entstandene Bassins umfassen den Parterrebereich.
Seine vier inneren Felder, die mit einer
zentralen Fontäne eine Gesamtfigur bilden, erscheinen auf fast alle
Plänen und Abbildungen als »Parterres
ä l'Angloise«, das heißt als durch
Zierwege ornamental gegliederte, von
»Platebandes Coupees en Compartiments«
gerahmte Rasen stücke. Die vier äußeren Felder sind von ebensolchen Bordüren eingefaßt, aber entsprechend dem damals üblichen Kompositionsprinzip
einer nach außen (mit zunehmender Entfernung
von Schloß und Mittelachse) abnehmenden Ausstattung und Ornamentierung
ungegliedert.
Den »Noveau Jardin« teilt ein Alleekreuz, in
dessen Zentrum die große Fontäne aufsteigt, in vier quadratische Areale, die mit Sternanlagen besetzt sind. Ihre Mittelpunkte, Rundplätze mit achteckigen Fontänenbassins,
ordnen sich wiederum im Quadrat um die große Fontäne. Die durch dieses Gliederungssystem
bedingten dreieckigen Kompartimente (»Triangeln«) enthielten mit wenigen Ausnahmen
regelmäßige Obstbaumpflanzungen.
Der Große Garten zu Herrenhausen gehört zu den
wenigen Barockanlagen, die in ihren wesentlichen Zügen erhalten geblieben
sind. Ein Vergleich seiner ursprünglichen, durch zahlreiche Quellen belegten
Gestaltung und Ausstattung zeigt jedoch, daß man bei den umfassenden, außerordentlich
verdienstvollen Restaurierungen der Jahre 1936/37 und 1960 bis 1966 nicht
überall den historischen Vorgaben gefolgt ist. Das gilt vor allem für die
Bepflanzung der »Triangeln« im »Noveau Jardin« oder für die Gestaltung der
Parterres.
Text:
Dieter Hennebo; in: Die Gartenkunst des Abendlandes, DVA, 1993
Die modernen Gärten der Expo 2000 in Hannover
 |
 |
Ich habe untenstehend einen Text
über diese einmaligen Gärten gefunden, die anlässlich der Weltausstellung
2000 in Hannover erstellt wurden. Er ist einigermassen trist und desillusionierend
und widerspiegelt das Bild der heute noch existierenden Gärten keineswegs.
Was hier nicht zuletzt vom Schweizer Landschaftsgestaltungsbüro Kienast, Vogt
und Partner geschaffen wurde, verdient ganz spezieller Beachtung. Allerdings
überarbeiteten sie den bereits bestehenden Entwurf von Guido Hager, ebenfalls
aus Zürich. Diese Gärten bildeten sozusagen das Rückgrat der Ausstellung.
Links und rechts von diesem langen Korridor oder Achse wurden die Länderpavillons
errichtet und die strahlen, soweit sie heute noch bestehen, eine ziemlich
faszinierende Morbidität aus.
So kam das Messegelände zu einer
klaren Struktur, mit eindeutig definierten Freiräumen, von denen auch die
Besucher aus aller Welt profitieren, wenn sie sich den von Oktoberfestzelt
und multimedialen Zukunftsprojektionen schwirrenden Kopf frei machen wollen.
Die Freiräume erleichtern die Orientierung. Von der in West-Ost-Richtung verlaufenden
"Allee der Vereinigten Bäume" gehen rechtwinklig nach Norden grüne
Finger ab, die "Parkwelle" und der "Erdgarten", alle von
der Arbeitsgemeinschaft Kienast, Vogt, Heimer + Herbstreit sowie der Messepark
am Ende der Allee. Ursprünglich hätte die Expo auf einem kompakten Rechteck
stattfinden sollen, doch im Laufe der Planung wurde eine Achse nach Süden
geklappt, was nun die Wege auf der insgesamt 160 Hektar großen Schau verlängert,
aber auch mehr Möglichkeiten für die landschaftliche Anbindung bot. Das Rückgrat
dieses Ostgeländes gestaltete der Berliner Landschaftsarchitekt Kamel Louafi
mit seinen "Gärten im Wandel", die vom städtischen Messeteil hinausführen
in den Expo-Park Süd und in den Parc Agricole.
Natürlich
sind dies keine Gärten im eigentlichen Sinne, oder aber Gärten für die Menschen
der Zukunft. Nein, keine Gärten, vielmehr Strukturen, welche der Architektur
entgegengesetzt wurden. Heute sind die meisten Bauten verschwunden, ein Zustand
der völlig unkonventionell ist. Sind es doch zumeist die Gärten, die verschwindet.
Und nun beurteilt man die Grünstücke an sich selbst. Sie machen es einem nicht
schwer hinunter zu steigen und sich in dieses ungewohnte Abenteuer einzulassen.
Es kommt ein ganz eigentümliches Gefühl auf, man wähnt sich in ein wahres
Wechselbad hineingeworfen, ändern sich die Töne doch laufend. Es ist durchaus
eine Ansammlung unterschiedlicher Texturen, Formen, Töne, Farben und Gefühle,
die man durchwandert. Über manches mag man sich wundern, gelegentlich schüttelt
man den Kopf, um dann wieder staunend stehen zu bleiben, zu verweilen.
Man
muss sich Zeit nehmen, um die Wirkung richtig auszukosten und man wünscht
sich, die Anlage würde Bestand haben.
 Die
Expo 2000 in Hannover ist Vergangenheit. Manch einer hat es nicht geschafft,
diese Weltausstellung zu besuchen. Doch jetzt sind die vielen Expo-Mitarbeiter
in alle Winde verstreut. Computer wie Pavillons haben neue Besitzer gefunden
oder werden abgerissen. Der Rückbau läuft, doch leider ist immer noch nicht
klar, was mit den preisgekrönten Grünanlagen auf dem Expo-Gelände-Ost, den
„Gärten im Wandel“ und dem „Expo Park Süd“, beide von Landschaftsarchitekt
Kamel Louafi mit seinem Team geschaffen, geschehen soll.
Die
Expo 2000 in Hannover ist Vergangenheit. Manch einer hat es nicht geschafft,
diese Weltausstellung zu besuchen. Doch jetzt sind die vielen Expo-Mitarbeiter
in alle Winde verstreut. Computer wie Pavillons haben neue Besitzer gefunden
oder werden abgerissen. Der Rückbau läuft, doch leider ist immer noch nicht
klar, was mit den preisgekrönten Grünanlagen auf dem Expo-Gelände-Ost, den
„Gärten im Wandel“ und dem „Expo Park Süd“, beide von Landschaftsarchitekt
Kamel Louafi mit seinem Team geschaffen, geschehen soll.
Die Parks liegen neben einem projektierten
Gewerbegebiet, das nach Hoffnung der Stadt durch hochkarätige Medien- und
Designfirmen belebt werden soll. Um die Plaza herum werden sich bald neben
der Preussag Arena mit ihren 14 000 Plätzen etwa 4 000 Studenten der neuen
Medienakademie tummeln. Angrenzend beziehen Leibniz-Akademie, Teile der Industrie-
und Handelskammer und eine Filiale des Technologiezentrums Hannover im Medienhaus
ihre Räume. 15 der 30 Pavillons auf dem Ostgelände werden auf jeden Fall abgerissen.
In Frankreichs schlichten Kasten zieht die französische Sportartikelfirma
Decathlon ein, in die Pavillons von Tschechien und Polen eventuell ebenfalls,
in den von Belgien kommen Büros. Über den Pavillon des CVJM, den „Wal“, ist
noch nicht entschieden, auch wenn vor der Schau klar war, dass das Gebäude,
das unsensibel in die Hauptachse des Parks gesetzt wurde, wieder verschwinden
muss.
Noch reicht diese Ansammlung neuer Nutzer aber nicht aus, um den Unterhalt
für zwei große und pflegeaufwendige Parks zu gewährleisten. Eine Nachnutzungskonzeption,
geschweige denn ein Pflegekonzept sind in der hektischen Planungs- und Bauphase
der Weltausstellung nicht entwickelt worden.
Ruinenpflege gegen Gartenkunst
Berechnungen des Grünflächenamtes, dem das Gelände bis auf das Regenwasserrückhaltebecken
wahrscheinlich demnächst übertragen wird, haben ergeben, dass die jährlichen
Unterhaltungskosten bei intensiver Pflege fast eine Million Mark betragen
werden. Hunderte Kastenlinden, Stauden- und Gräsergärten, Wasseranlagen, Rasentreppen,
zahlreiche Bauten und ein Damm mit einer 1:1-Steigung können nicht kostenlos
gepflegt werden, obwohl das dem Kämmerer der Stadt sehr gut gefallen würde.
Diskutiert, aber eigentlich noch nicht ernsthaft erwogen, wird ein Rückbau
aller aufwendigen Teile, wie Türme, Wasserbecken, pflegeintensive Wegebeläge,
Schleusen und alle Arten von Schmuckpflanzungen. Das würde allerdings den
Charakter dieses wichtigen zeitgenössischen Parks unwiederbringlich zerstören.
Nach Einschätzung des Grünflächenamtes lässt sich leider von der teilweise
viel zu dichten Pflanzung im Expo Park Süd nur wenig gewinnbringend veräußern.
Lediglich über den Wiederverkauf der etwa 80 à la japonaise geschnittenen
Kiefern gibt es bereits Verhandlungen. Die übrigen Großbäume, die als Europas
teuerste Lärmschutzwallbepflanzung in Abständen von 3 x 3 Metern plus Unterpflanzung
mit Sträuchern und Stauden als Ausstellungskulisse gesetzt wurden, sind wegen
des angeschütteten Kalkmergelmaterials nicht ohne Beschädigungen der Bäume
und der Böschungen wieder zu entfernen. Nach dem Ablauf der Entwicklungspflege
Ende 2001 werden wohl die Bäume ihrem Schicksal überlassen und diejenigen,
die es nicht schaffen, abgesägt. Die Unterpflanzungen werden sich arrangieren
müssen. Anders als bei vielen Nachnutzungen von Gartenschaugeländen, die in
den betreffenden Städten meist ein Grünflächendefizit ausgleichen konnten,
ist Hannover ja bekanntermaßen mit attraktiven Parkanlagen gut versorgt, so
dass ein umzäunter Park mit Eintritt hier nicht in Frage kommt, zumal an einem
Ort, der weit von der Hannoverschen Wohnbebauung entfernt liegt.
Ein weiterer Pflegetypus wäre eine Art „Ruinenpflege“, die für weniger als
200 000 Mark jährlich zu haben ist. Dabei würden die Strukturen erhalten bleiben.
Die Kastenlinden könnten aber frei wachsen, ein eventueller Schnitt aus Sicherheitsgründen
ähnlich alter barocker Alleen in einem Zeitraum von zwanzig bis fünfzig Jahren
einkalkuliert.
Die jetzigen Rasenflächen würden extensiv mit dem Schlegelmäher von Verbuschung
freigehalten, die flachen Wasserbecken angebohrt und mit Kies aufgefüllt.
Ob den erhofften hochkarätigen Gewerbenachbarn allerdings diese Ruinenromantik
gefiele, wage ich zu bezweifeln. Die Stadt hofft auf ein Engagement der Firmen,
für die die Parks ein Aushängeschild und für das Personal ein schöner Erholungsort
sein könnte. Das in der Nähe am Kronsberg liegende Beispiel der Firma dvg,
die der Stadt den Bau des Spiel- und Sportparks finanzierte und auf einem
Bauerwartungsgelände einen temporären Park einrichtete, zeigt, dass so etwas
durchaus möglich ist.
Noch nicht abzusehen ist die Annahme der Parks durch die Menschen vor allem
des benachbarten und mit Grün unterversorgten Laatzen, die den Park über zwei
Brücken erreichen können. Schon viele Laatzener haben den neu entwickelten
Kronsberg mit dem Parc Agricole, der Kammbewaldung, dem Aussichtshügel und
die Hermannsdorfer Landwerkstätten als Naherholungsziel entdeckt. Doch befürchte
ich angesichts der vielen hundert Meter Betonwände in den „Gärten im Wandel“
und im „Expo-Park Süd“, in denen kaum eine soziale Kontrolle herrscht, dass
die Graffiti- und Tagsprayer rasch ein wunderbares Betätigungsfeld finden
werden. Eine Pflege der Parks über eine Gesellschaft oder einen Verein mit
Beteiligung aller Nachbarn, wie Stadt Hannover, Stadt Laatzen, Messe AG und
Gewerbeanlieger ist in der Diskussion. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit,
die hohen Parkpflegekosten auf mehrere Schultern zu verteilen und die Parks
als wichtige grüne Zeugen der ersten und einzigen Expo in Hannover zu erhalten.
Ronald
Clark; in: Garten und Landschaft 2000/11
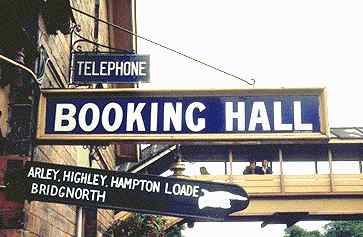 |
Klicken Sie hier drauf, um sich provisorisch oder definitif anzumelden oder zusätzliche Unterlagen anzufordern |  |
Kehre zurück zur Gartenreise-Hauptseite |  |
Ich will mehr über Graf Gartenbau erfahren |