 Hans
Graf Gartenbau CH-3065 Bolligen hansgraf@bluewin.ch
Hans
Graf Gartenbau CH-3065 Bolligen hansgraf@bluewin.ch
Gärten in Holland und Norddeutschland
/ Teil 2
Der Schlossgarten von Hetloo
 |
 |
Der Statthalter Prinz "Wilhelm III. von Oranien
beschloß im November 1684, in unmittelbarer Nähe
von Apeldoom ein neues Jagdschloß
zu erbauen. Über seinen Botschafter in Paris erging im Dezember an die Academie Royale d'Architecture die
Bitte, einen Plan zu erstellen. Er verlangte, wie aus dem Protokoll der Sitzung
vom 15. Dezember 1684 hervorgeht: »ein Corps de logis
über gewölbten Kellern, enthaltend ein Vestibül, ein Treppenhaus und zwei
Appartements mit Nebenräumen«.
Dem Protokoll vom 6. April 1685 der Akademie
ist zu entnehmen, daß der holländische Botschafter
an diesem Tage die Akademie aufsuchte, um ihr für die Zeichnungen, die sie
für den Prinzen von Oranien angefertigt hatte, zu danken. Diese Pläne sind
weder in Frankreich noch in Holland wiedergefunden
worden. Sie gelten als Grundideen, auf deren Basis der holländische Architekt
Jacob Roman (16401716) und der Architekt französischer Herkunft Daniel Marot
(16631752) die Pläne für Het Loo
erarbeiteten.
Het Loo wurde in zwei schnell aufeinanderfolgenden
Bauphasen realisiert, die erste begann im Frühjahr 1685. 1687 bestand Het Loo aus einem Corps de logis mit zwei ViertelkreisKolonnaden,
die, dem palladianischen Prinzip entsprechend, die
Verbindung mit den Flügeln herstellten. Diese Kolonnaden wurden 1687 von dem
bekannten schwedischen Architekten Nicodemus Tessin,
als er auf der Durchreise nach Paris Het Loo einen Besuch abstattete, vermessen und genau beschrieben.
Die Grünanlagen beschränkten
sich vorläufig auf den sogenannten Unteren Garten
und die zwei Seitengärten, die ab 1689 Königs und Königinnengarten genannt
wurden. Kennzeichnend für den Entwurf waren der strenge geometrische Aulbau,
die konsequent durchgehaltene Symmetrie und die Renaissanceelemente der Gestaltung.
Folgende Bedingungen auf dem Terrain waren vorgegeben: an der Nordseite die
bestehende Allee zum Oude Loo,
seitdem bekannt als Querallee (Dwarslaan); an der
Südseite, angrenzend an den Vorhof, die Königsallee (Koningslaan),
das Oude Loo an der Westseite
und die Grundstücksgrenze an der Ostseite.
Der Bereich zwischen
beiden Alleen war präzise geteilt. Das Corps de logis,
die zwei Kolonnaden, die Flügel, der Königsund Königinnengarten lagen südlich
der Mittelachse. Nördlich von dieser Linie befand sich der Untere Garten,
ausgeführt als solle de dehors und erreichbar über
die breit ausgefächerte Podesttreppe zur Mittelallee.
Einzigartig für die Niederlande waren die hochgelegenen
Wandelterrassen, die U - förmig um den unteren Garten
führten und an der Nordseite von der Querallee mit vier Reihen Eichen abgeschlossen
wurden. Von den Terrassen blickte man auf acht quadratische Parterres, von
denen die vier mittleren Broderieparterres waren. Weiter ging der Blick auf
die Bassins, Kaskaden, Brunnen und auf die Rabatten mit Blumen, Sträuchern
und beschnittenem Blumenwerk. An den Hauptpunkten der geometrischen Anlage
standen Skulpturen aus weißem Marmor sowie weiß gestrichenem Sandstein und
blattvergoldetem Blei und schließlich Vasen aus
Naturstein, Blei und Terrakotta.
Sowohl der Königs als auch der Königinnengarten
waren von der hohen Terrasse aus über gemauerte Treppen
an den Stirnseiten der Gartenmauer erreichbar.

 |
Der Königsgarten bestand
aus zwei Teilen. Der direkt an das Haus angrenzende Bereich zeigte in allerlei
Figuren geschnittenen Buxus. Zwei Parterres waren
von Rabatten eingefaßt. Hierin standen Pflanzen
und Blumen sowie in regelmäßigem Abstand pyramidenförmige Wacholdersträucher
oder Buchsbaum.
Im Zentrum der Anlage lag ein achtekkiges weißes Marmorbassin mit einem vergoldeten speienden
Triton in der Mitte und acht vergoldeten speienden
Seedrachen auf dem Rand. Im anderen Teil des Gartens, in Höhe der Pferde
ställe, lag die vertiefte Rasenfläche für
Spiele an allen vier Seiten von einem breiten Kiesweg umgeben. Über
eine schmiedeeiserne Pforte in der Garten mauer war
der Königsgarten mit dem La byrinth und weiter mit
einem Komplex aus Gärten, Wasserpartien
und einer Me nagerie,
seitlich und hinter dem Oude Loo gelegen, verbunden.
Der Königinnengarten lag an der Ost seite des Corps de logis und war
über eine separate Treppe vom Appartement
der Königin im ersten Obergeschoß zum
Souterrain erreichbar. Hier endete die
Treppe in einem Raum, der an die Muschelgrotte
angrenzte, so daß die Königin den Garten über diese Grotte erreichen konnte.
Auch dieser Garten bestand aus zwei Teilen. Der eine an den Unteren Garten angrenzende, hatte drei Parterres, wovon zwei mit Rabatten gesäumt waren. Zwi schen den beschnittenen Buxusrändem dieser Rabatten standen die in Pyramidenform geschnittenen
Wacholdersträucher und dazwischen wiederum die Pflanzen und Blumen. In der
Mitte befand sich das weiße Marmorbassin des Arion.
Auf dem Rand des Bassins saßen acht vergoldete speiende Seepferdchen. Der
zweite Teil des Gartens lag vier Stufen höher und bestand in voller Länge
und Breite aus mehreren Laubgängen von Hainbuche. Er enthielt fünf Fontänen
mit blattvergoldeten speienden Tritonen,
sitzend auf Felsen aus Steinen und Muscheln in Bassins aus Felswerk und Kieselmosaik.
Durch eine schmiedeeiserne, blau und gold gestrichene
Gartenpforte in der östlichen Gartenmauer konnte man den Königinnengarten
verlassen und sich in die angrenzenden Gärten mit hohen Hecken, Wandelpfaden,
Brunnen, Wasserfällen, Felspartien, Treillagen,
Skulpturen, Vasen und Sitzbänken begeben. Auch diese Seitengärten sind verschwunden.
Nach der Krönung von Wilhelm III. und Maria
Stuart zu Herrschern von England und Schottland im Jahre 1689 wurde Het Loo erweitert. An der Stelle
der Viertelkreiskolonnaden entstanden vier neue Pavillons, die Kolonnaden
wurden in den Garten versetzt. Sie dienten dort als Abschluß
des höhergelegenen Oberen Gartens. Die Eichenquerallee
zwischen Unterem und Oberem Garten erhielt dadurch den Charakter einer »grünen
Kolonnade« zwischen den beiden architektonischen Gärten.
Prunkstück im Oberen Garten war das achteckige
Bassin mit einem Durchmesser von 32,5 Metern und der dreizehn Meter hohen
Königsfontäne, die aus natürlichen Quellen gespeist wurde, so daß sie Tag und Nacht in Betrieb war. Vom Standpunkt zwischen
den zwei Viertelkreiskolonnaden in der Achse der Gesamtanlage fiel das Auge
auf den 800 Meter entfernten Obelisken, einem klassischen Blickfang und passend
zu einem königlichen Barockgarten.
Als Walter Harris, der Leibarzt von Wilhelm
III., 1699 seine sorgfältige Beschreibung publizierte, befanden
sich Het Loo und insbesondere
der Garten in ihrem schönste Zustand.' Sie waren bereits damals weit über
die Landesgrenzen hinaus bekannt.
Im 18. Jahrhundert wurden die Gärten so gut
wie möglich instand gehalten. Die Eichen der Querallee wurden durch Buchen
ersetzt, und die architektonische Anlage des Oberen Gartens wurde in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts in einen Landschaftsgarten nach dem Entwurf von
Philip W. Schonck (17351823) ersetzt.
Nach dem Abzug der Oranier
wurde Het Loo in der Zeit
der Batavischen Republik geplündert, und der Garten
verkam vollständig. In der kurzen Periode
(18061810) der Herrschaft von Louis
Napoleon wurden nach dem Entwurf des
Franzosen Alexandre Dufour (1750 1835) die Reste der formalen Gartenan lage entfernt, ohne jedoch
die geplanten Teiche auszuführen
wegen der Angst Louis Napoleons vor dem Wasser.
1979 wurde der Garten nach umfassen den historischen
Forschungen und sorg fältigen Ausgrabungen in der
ursprüng lichen Form rekonstruiert.
Gleichzeitig erfolgte der Umbau des
Schlosses zu einem Museum.
Text:
Jan van Ansbeck; in: Die Gartenkunst des Abendlandes,
DVA 1993
Kijktuinen Goedegebuure
Der
geneigte Leser wird bemerkt haben, dass ich von den unzähligen Schaugärten,
die Holland überziehen, zumeist nicht sehr viel halte. Aber die Gattung hat
sich zu einem eigentlichen Gartenstil entwickelt und beginnt vermutlich, ihren
Platz in der Geschichte der niederländischen Gärten einzunehmen. Obwohl die
Autoren des grossen Standardwerkes über die holländischen Gärten auf diese
Gattung noch nicht eingegangen sind, möchte ich es nicht unterlassen, wenigstens
diesen Garten (neben dem von Mien Ruis) in die Betrachtungen mit einzubeziehen.
Das
Büro Goedegebuure stellt hier zunächst seine Leistungsfähigkeit
und Kreativität unter Beweis. In der Art eines ‚Jardins en suite‘ werden 19 unterschiedliche Gartentypen vorgestellt.
Am meisten überzeugen die Gärten, in denen Pflanzenkombinationen dominieren.
Man wird neidig ab der Vielzahl von Zusammenstellungen,
die hier gezeigt werden. Verblüfft ist man beispielsweise ob den Aussaaten
mit Einjahresblumen, die daherkommen wie kräftige Blumenwiesen ohne Gräser,
gehalten in monochromen Farben. Leider muss die Pracht vermutlich jedes Jahr
neu ausgesät werden, ist mit gelungener Selbstversamung
doch kaum zu rechnen. Im Gegenteil: es musste nach der Neuaussaat
gar ausgejätet werden, ein heikles Unterfangen, da in diesem Stadium kaum
feststellbar ist, was Kraut und was Unkraut ist. Aber das Ergebnis lässt sich
sehen; eine gute Möglichkeit der Begrünung von Flächen, die ein oder zwei
Jahre brach liegen sollen. Die Staudenbepflanzungen sind traditionell-gekonnt
angelegt. Sie verbinden die deutsche mit der englischen Tradition, arbeiten
sehr schön Ton in Ton, geordnet nach Jahreszeiten, verzichten aber auf Sommerblumen,
stellen Leitstauden ins Zentrum und gehen durchaus auf gewisse Knalleffekte
aus. Auch die Tiefenstaffelung wird berücksichtigt, alles ist sehr perfekt
gepflegt, so dass es schon beinahe künstlich aussieht und
ihm Charme
Im Gegenteil: es musste nach der Neuaussaat
gar ausgejätet werden, ein heikles Unterfangen, da in diesem Stadium kaum
feststellbar ist, was Kraut und was Unkraut ist. Aber das Ergebnis lässt sich
sehen; eine gute Möglichkeit der Begrünung von Flächen, die ein oder zwei
Jahre brach liegen sollen. Die Staudenbepflanzungen sind traditionell-gekonnt
angelegt. Sie verbinden die deutsche mit der englischen Tradition, arbeiten
sehr schön Ton in Ton, geordnet nach Jahreszeiten, verzichten aber auf Sommerblumen,
stellen Leitstauden ins Zentrum und gehen durchaus auf gewisse Knalleffekte
aus. Auch die Tiefenstaffelung wird berücksichtigt, alles ist sehr perfekt
gepflegt, so dass es schon beinahe künstlich aussieht und
ihm Charme  des natürlich- unzulänglichen etwas abgeht.
des natürlich- unzulänglichen etwas abgeht.
Sehr
hübsch sind wiederum die Spalieranlagen. Einerseits wird eine Stahlpergola
gezeigt, wo verschiedenartige Apfelsorten gezogen werden. Eine andere Querachse,
ebenfalls als Pergola gehalten, dient einer sehr schönen Clematisshow.
Nicht so begeistern mochten mich die Ausflüge
in die Exotik. Es braucht allerhand Mut, eine Plaza
Alhambra zu gestalten, diese wirkt aber doch etwas steril
und schematisch. Es gelingt meines Erachtens nicht, die Seele des maurischen
Gartens einzufangen. Vielleicht liegt es an der etwas aufdringlichen Materialwahl
(gelber Hartsandstein?) und den verschiedenen Klischees, die einbezogen wurden.
Andererseits
fehlt im Garten der Mut zum Experimentieren, zum Aufbrechen der konventionellen
Grenzen. Alles ist sehr brav und gleichsam klassisch gehalten. Der Wassergarten
mit seinen ovalen Becken ist gekonnt gestaltet aber wiederum innerhalb bekannter
und gewohnter Normen. Und man wünschte sich vielleicht mal einen Rosen- oder
Kräutergarten, der vom klassischen Grundriss abweicht.
Nun,
die Anlage soll vermutlich in erster Linie verkaufsfördernd
sein, soll
mögliche Beispiele aufzeigen und dem potentiellen Kunden sozusagen seinen
neuen Garten vorführen. Insofern haben solche Anlagen durchaus Berechtigung,
aber man möchte sich durchaus etwas mehr Mut zum Experiment wünschen.
Der Garten von Mien Ruys
Mien Ruys, eine der bedeutenden holländischen Garten-
und Landschaftsarchitektin der klassischen Moderne, wurde 1904 in Dedemsvaart geboren. Hier gründete ihr Vater 1888 die  heute noch existierende und bedeutende Staudengärtnerei
Moerheim. 1916 gliederte er ein Gartenarchitektur-Büro
an, in dem Mien Ruys 1923 zu arbeiten begann. 1925 baute sie seinen ersten
Garten, später arbeitete sie auch in Deutschland und England. Dort traf sie
unter anderem auch mit Gertrude Jekyll in Monstead
Mood zusammen. 1930 übernahm sie die Leitung des Planungsbüros
Moerheim, das sie 1937 nach Amsterdam verlegte.
Ihre Stärken liegen in der Planung von Pflanzungen, sie arbeitete aber auch
in der Landschaft (Nationaal Park De Hoge Veluwe, Stadswallen
/Vestingwerken Elburg).
heute noch existierende und bedeutende Staudengärtnerei
Moerheim. 1916 gliederte er ein Gartenarchitektur-Büro
an, in dem Mien Ruys 1923 zu arbeiten begann. 1925 baute sie seinen ersten
Garten, später arbeitete sie auch in Deutschland und England. Dort traf sie
unter anderem auch mit Gertrude Jekyll in Monstead
Mood zusammen. 1930 übernahm sie die Leitung des Planungsbüros
Moerheim, das sie 1937 nach Amsterdam verlegte.
Ihre Stärken liegen in der Planung von Pflanzungen, sie arbeitete aber auch
in der Landschaft (Nationaal Park De Hoge Veluwe, Stadswallen
/Vestingwerken Elburg).
Anschliessend an das Areal der Staudengärtnerei in Dedemsvaart
entstanden ca ab dem Jahr 1954 verschiedene Schau-
und Wohngärten. Ruys verbrachte die Sommermonate
immer hier, so dass die Gärten durchaus auch zu Wohnzwecken dienten.
Das
Ensemble ist nach dem Prinzip der Kammergärten angelegt, in einem rechteckigen
Grundriss sind die einzelnen Themengärten locker hineinkomponiert, wobei gerade
auch auf die Übergänge grosser Wert gelegt wurde.
In lockerer Abfolge sind bis 1999 unter
Ruys Leitung und vermutlich auch Planung rund 20 Einzelgärten
entstanden. Deren Sprache ist eindeutig, wenn man von den reinen ‚Technik-Gärten‘
(Dachgarten, Staudenneuheiten) einmal absieht. Im neuen Gartenbereich domininieren
die schlichten Formen, das Rechteck bestimmt die Sprache. Die gepflegte Rasenfläche
dient als passives, ausgleichendes Element.
Im
alten Versuchsgarten, in dem er bereits 1924 mit Stauden zu experimentieren
begann, entdeckt man die alte, englische Staudenrabatte
und den Verwilderungsgarten, der unter alten Apfelbäumen rund um ein quadratisches
Wasserbecken entstanden ist. Dessen einfache, gradlinige Architektur mit einer
üppigen Bepflanzung als Kontrast ist typisch für die Entwürfe Ruys‘.
In diesem ältesten Bereich fühlt man sich in der Tat zurückgesetzt in die
Zwischenkriegsjahre, die Möblierung ist zurückhaltend, die Pflanze dominiert,
die Materialwahl beschränkt sich auf Bewährtes.
Im neuen Bereich, ab
  |
1960 entstanden, wird mit modernen Materialien
wie Polyester und Bahnschwellen experimentiert. Aber Ruys bleibt ihren Prinzipien treu. Gerade Linien, das Rechteck
und das Quadrat dominieren und bestimmen das Konzept jedes Gartens. Dies ergibt
diesen harmonischen Gesamtzusammenhang, die gesamte Anlage erscheint wie aus
einem Guss, zumal man auch bei der Auswahl der sichtbaren Materialien zurückhaltend
ist.
In
der Folge seien die einzelnen Gärten beschrieben, wie sie die ‚Stichting Tuinen Mien Ruys‘ zur Verfügung stellt.
1.
Garten mit Mühlstein (1984, renoviert 1994)
Unter einer Pergola hindurch, vorbei am 'Mühlstein' aus Beton und einer Fläche
von Pestwurz führt der Weg zu der Pforte, hinter der die Versuchsgärten liegen.
2.
Alter Versuchsgarten (1927)
Eine 'englische' Staudenrabatte, 30 m lang und 4 m breit, die bepflanzt ist
mit Stauden für einen sonnigen Standort, die von Mitte Mai bis Ende September
in bunter Reihenfolge blühen. Der Weg aus verwitterten Betonplatten inspirierte
Mien Ruys zum Entwurf des 'Grionsteines', einem Vorläufer der Waschbetonplatten.
3.
Verwilderungsgarten (1924, renoviert 2001)
Dieser älteste Gartenabschnitt entstand unter alten Apfelbäumen rundum ein
quadratisches Wasserbecken. Die einfache, gradlinige Architektur mit einer
üppigen Bepflanzung als Kontrast ist typisch für die Entwürfe von Mien Ruys.
4.
Bank bei der Wasserkugel (1970)
Verwilderungspflanzen im Schatten. Sträucher und Bodendecker blühen im Frühjahr,
bevor die Bäume Laub haben. Später sorgen die unterschiedlichen Blattformen
für Abwechslung.
Von der Bank aus ist unter den Zweigen des Haselstrauches auf der einen Seite
die Farbenpracht des grossen Staudenbeetes zu sehen
und auf der anderen Seite das faszinierende Spiel des Lichtes auf der Betonkugel,
aus der Wasser sprudelt.
5.
Wassergarten (1954)
Verschiedene Niveaus machen es möglich, dass auf einer kleinen Fläche neben
Wasser- und Sumpfpflanzen auch Steingartenpflanzen wachsen. Eine alte, dicke
Koniferenhecke und die hundert jährige Hängebirke bilden den eindrucksvollen
Hintergrund.
6.
Kräutergarten (1957, renoviert 1996)
Rundum kreuz- und kreisförmige Buchsbumhecken mit
Muschelpfaden befinden sich Beete mit Küchen-, Heil- und Färbekräutern. Rasenbank,
Brunnen, geschnittene Formen und eine Hexenkugel sind hier passende, mittelalterliche
Gartenelemente.
7.
Garten beim Gärtnerhaus (1981, erweitert 1998)
Durch das Anlegen von Höhenunterschieden wurde das Mikroklima beeinflusst.
Es entstanden sowohl schattige und feuchte wie sonnige und trockene Bereiche.
Die Pflanzen gedeihen nur dort, wo sie die ideale
Wachstumsbedingungen finden. Im Helophytenpavillon
finden Sie u.a. Information über die Schilfkläranlage.
Die Route führt am Kompost vorbei durch den Wald.
 8. Waldgarten (1987)
8. Waldgarten (1987)
Dieser Eichenwald stammt aus dem 19. Jahrhundert. Der stille Kreis von Sauerklee,
umsäumt von Rhododenron, formt einen Ruhepunkt beim
Spaziergang durch den Wald.
Wenn Sie aus dem Wald kommen, können Sie einen Blick in die renovierte Bauernscheune
werfen, wo eine Ausstellung über die Versuchsgärten informiert.
9.
Standartrabatten (1960)
Beispiele von Rabatten verschiedener Grösse, für
die anspruchslose Stauden in Pasteltönen oder grellen
Farben verwendet wurden, die zwischen Mai und September blühen.
Geschnittene Hecken aus verschiedenen Gehölzen in unterschiedlicher Höhe bilden
den Hintergrund.
10.
Senkgarten (1960, renoviert 1995)
Durch kleine Höhenunterschiede, die mit Bahnschwellen angelegt wurden, entstand
ein intimer Gartenraum. Mien Ruys
war die erste Gartenarchitektin, die alte Bahnschwellen in ihren Entwürfen
verwendete.
11.
Sonnenrabatten (1960)
Zwischen einer hohen, laubabwerfenden Hainbuchenhecke
und einer niedrigeren, immergrünen Eibenhecke befinden sich zwei weitere Standartrabatten.
12.
Schilfteich (1960)
Da Mien Ruys neue Materiale
erst selbst testen wollte, wurde hier vor mehr als 40 Jahren eines der ersten
Wasserbecken aus Polyester eingegraben. Mit einem Zwergstrauch und einer kleinen
Terrasse mit einer Betonbank und dahinter Riesenschilf (Miscanthus giganteus) formt dieser
Teich eine harmonische Einheit.
13.
Staudenneuheiten (1999)
Umschlossen durch die Pergola und eine Buchenhecke ist hier dieses Jahr eine
Geraniumkollektion von mehr als 200 Sorten und Varietäten
ausgepflanzt.
14.
Dachgarten (1999)
Experiment mit Dachgartensystemen. Beim hier angewendeten System sorgt eine
wasserspeichernde Schicht dafür, dass Pflanzen nicht vertrocknen.
Die Pflanzen wachsen in einem speziellen Leichtgewichtigsubstrat.
15.
Moorgarten (1990)
An der flachen Böschung dieses grossen Teiches finden
Wasser-, Sumpf- und Uferpflanzen ihren eigenen Standort. Die Lattenroste aus
wiederverwertetem Kunststoff sorgen mit ihrem Linienspiel für einen kontrastierenden
Akzent.
16.
Gelber Garten (1982)
Die ganze Palette von gelb erstrahlt hier durch weniger bekannte Stauden in
all ihren Schattierungen von crèmefarbig bis tieforange.
17.
Gemischte Rabate (1974)
Ein Beet von 25 m lang und 2.5 m breit in voller Sonne ist bepflanzt mit Stauden
und Rosen in karminrot, lila und rosa Farbtönen,
abgewechselt mit rotblättrigen Sträuchern.
18.
Eckgarten (1999)
Im Schutz einer doppelten Hecke liegt ein Sitzplatz inmitten einer ruhigen
Bepflanzung von grossen Staudengruppen in Pastelltönen.
19.
Geschnittener Garten (1999)
Streng gestalteter Garten mit Hecken von verschiedener Höhe und Form. Ein
rechteckiges 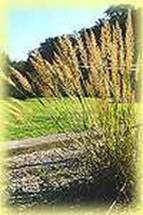 Wasserbecken
ist das zentrale Element, in dem drei Skulpuren
des Künstlers Henk Rusman stehen.
Wasserbecken
ist das zentrale Element, in dem drei Skulpuren
des Künstlers Henk Rusman stehen.
20.
Neue Border (2000)
Ein neuer Umgang nit den Begriff "Border" mit seiner natürlichen Bepflanzung.
21.
Blumenterrasse (1982)
Beim Anlegen der Terrasse wurden in spielerischer Anordnung Pflanzflächen
ausgespart, die mit Stauden und Sträuchern für kalkreicheren Boden bepflanzt
sind.
22.
Gräser (1993)
Ein vertieft angelegtes Quadrat mit neuen oder weniger bekannten Ziergräsern
in Flachkornkies.
23. Stadtgarten (1960)
Ein einfacher, kleiner Garten, der grösser wirkt
als er ist, weil die längst mögliche Linie (die Diagonale) frei gelassen wurde
und der Garten nach hinten zu 15 cm ansteigt, während die Fugen zwischen den
schräg gelegten Steinen stets breiter werden.
24.
Garten aus Vierecken (1974, renoviert 1997)
Ein Garten, der aus Quadraten aufgebaut ist, mit einem Teich von Plastikfolie.
25.
Bienenweide (1974, renoviert 1989)
Im Laufe des Jahres wird hier ein Herbstgarten angelegt, weil dieser Garten
langsam zu schattig wird für Bienen.
Priona Tuinen
Bei
dem im Übersichtsprogramm erwähnten Garten Schuinesloot
handelt es sich natürlich nicht um einen Schweinegarten. Schuine
heisst eigentlich schräg und der Garten eigentlich
Priona Tuinen. Knapp haben wir den
Eintritt in diesen Garten nicht geschafft. Der Hausherr - ein Gartenarchitekt
- war eben am Weggehen und verwies auch auf die Öffnungszeiten. Und an diesem
Tag war eben geschlossen. Er meinte, sein Garten sei gerade etwas verwildert,
aber diese Ausrede hörten wir des öfteren
und es stellte sich immer als masslose Untertreibung
heraus. Es soll sich dem Vernehmen nach um einen wundervollen grossen Garten handeln, der eingeteilt ist in verschiedene
kleinere Abteilungen. Vom Schattengarten via den Hochstaudengarten und Waldgarten
gelangt man zum Schmetterlingsgarten und von dort wieder zur Teeterrasse.
Oder so ähnlich, wenn ich den holländischen Text einigermassen richtig verstehen. Und irgendwann trifft man
auch auf die Buchs- und Taxuskunstwerke von Kaatjes
(oder Elisabeth de Lestrieux) und dieser Schnittkunst
begegnet man auch in Form
der
in Buchs weidenden Hühner - oder sind es Schafe? Man darf improvisieren. Lassen
wir uns überraschen.
Die Gärten in Groningen
Worüber
man nichs sagen kann, soll man schweigen. So jedenfalls
umschreibt es der wiener Philosoph Wittgenstein.
Und er hat völlig recht damit. Ich habe diese Gärten, die wir da besuchen
werden, noch nicht gesehen. Es entspricht einem guten alten Brauch, dass ich
das Recht habe, ein paar Gärten auf meinen Gartenreisen als Primeur zu erleben. Und die in Groningen gehören nun dazu.
Nicht dass wir die Katze im Sack kaufen müssten. Beileibe nicht! In den höchsten
Tönen wurde mit beispielsweise vom Kunstgarten in Paterswold
geschwärmt und zwar von Leuten, deren Gärten zu schönsten gehören, was ich
gesehen habe. Also muss etwas dran sein.
Die
weiteren Gärten, der Wassergarten Jonkerswart, der
Kuckgarten de Kruidenhof und vor allem der Renaissancegarten
in Uithuizen, eine Rekonstruktion eines zeitgenössischen
Gartens, werden uns sicherlich nicht enttäuschen.
Aber
eben: worüber man nichts sagen kann, soll man schweigen.
Weiter
zu Teil 3: Gärten in Holland und Norddeutschland / Teil 3
Zurück
zu Teil 1: Gärten in Holland und Norddeutschland / Teil 1
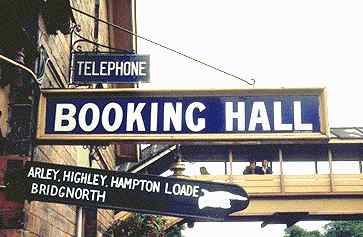 |
Klicken Sie hier drauf, um sich provisorisch oder definitif anzumelden oder zusätzliche Unterlagen anzufordern |  |
Kehre zurück zur Gartenreise-Hauptseite |  |
Ich will mehr über Graf Gartenbau erfahren |